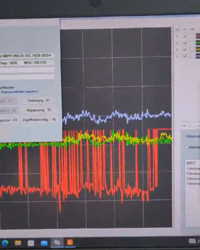Fotos: Barbara Zeininger
WIEN / Akademietheater:
EISWIND / HIDEG SZELEK von Árpád Schilling und Éva Zabezsinszkij
Uraufführung
Premiere: 25. Mai 2016
Man erinnert sich… Das waren noch Zeiten, als Vaclav Havel in der Tschechoslowakei im Gefängnis saß und seine Werke verboten waren, die das Burgtheater des Achim Benning unermüdlich spielte, wobei man den abwesenden Autor frenetisch beklatschte. Das war Agitprop, wie es das Theater eines demokratischen Nachbarlandes leisten konnte und wollte – und dass diese Ausnahmegeschichte noch ein Happyend hatte, als ebendieser Vaclav Havel dann Staatspräsident der Tschechoslowakei wurde… das war ein politisches Märchen, wie es wohl nicht wiederkommen wird.
Nun, Jahrzehnte später, steht es wieder in einem österreichischen Nachbarland politisch nicht zum Besten, und wieder öffnet das Burgtheater seine Bretter einem Dissidenten, der bei sich zuhause in Ungarn unerwünscht ist, aber wenigstens „frei“ genug, um im Ausland seine politischen Statements abzugeben.
Nun kann man leider nicht sagen, dass das Stück mit dem deutsch / ungarischen Doppeltitel „Eiswind / Hideg szelek“, das Árpád Schilling zusammen mit Éva Zabezsinszkij schrieb, nur deshalb ein gutes Stück ist, weil es in die Anti-Orbán-Kerbe schlägt. Gesinnung reicht ja nun wirklich nicht, war nie ein Ersatz für Qualität, die hier schmerzlich mangelt. Aber immerhin, ein Zeichen wurde gesetzt. Es ist halt bloß künstlerisch nicht so schrecklich überzeugend ausgefallen.
Im Kino wäre das ein Krimi, ein Psychothriller – das einsame, festungsartige Haus am Berg, irgendwo im Wald, irgendwo an der Grenze zwischen West und Ost. Die Besitzer sind verweichlichte Westler – der Vater, ein Professor und ehemaliger DDR-Idealist (!!!), der sich zu Tode schämt, dass er sich vom Kapitalismus kaufen ließ; die Mutter eine unangenehme, ihre Umwelt gnadenlos attackierende Egozentrikerin; der Sohn, von Beruf Schauspieler, kifft. Immerhin kann er ein bisschen Ungarisch…
Wenn das Stück beginnt, kommt zuerst Ilona – sie ist ein Flüchtling von „drüben“ (man kann das Ganze weder in Ort, Zeit noch Handlung real festmachen, es lebt im Raum des „Gleichnisses“), der hier „putzt“. Im Kino hätte man sie auch gleich im Verdacht, was Unrechtmäßiges zu wollen, aber später stellt sich heraus, dass diese als „Unruhestifterin“ verfemte Frau letztendlich die „Gute“ ist… Sie kommt (wie Schilling zu uns) zu den Bedrohten, um sie zu warnen, und wird dafür letztendlich verleumdet, gefesselt und geknebelt…
Verfolgt wird sie von ihrem Mann, der „drüben“ Polizist ist, sie heimholen will, die westlichen Hausbesitzer attackiert und sich gleichzeitig bei ihnen einnistet. Weil draußen erst ein Sturm tobt, außerdem „die Wölfe“ hausen, nehmen die Schwachen die Hilfe des „Starken“ angesichts der Gefährdung nur zu gerne an, lassen sich sogar Gewehre in die Hand drücken, bauen Zäune, gehen sogar auf einander los – der zuerst so schwächliche Sohn fühlt sich mit dem Knüppel in der Hand stark genug, auf den eigenen Vater einzuschlagen…


Ja, und wenn es Sündenböcke geben muss, dann sind die Frauen ausersehen (Ilona wird zur Feindin erklärt und beinahe geopfert), die allerdings doch Überraschungen in petto haben: Als der böse Faschist (längere Zeit splitterfasernackt zur ausführlichen Betrachtung) nun auch die Frau des Westlers genießen will, entsinnt sie sich ihres biblischen Namens: Judith. In einer kaum zu erspielenden, peinlichen Szene, wo sie den Nackten wäscht und ihm im unausgesprochenen Versprechen sinnlicher Freuden die Augen verbindet, zückt sie dann das Messer und schneidet ihm (na ja, nicht ganz natürlich) den Kopf ab.

Gleich geht’s zur Sache: Nacktfotos des Hauptdarstellers wurden nicht gestattet
Gerettet ist damit letztendlich noch nicht alles, denn wie sie jetzt mit dem eigenen radikalisierten Sohn umgeht, der das Gewehr vermutlich auch gegen sie richten würde… was weiß man. Da fällt der Vorhang langsam in die Ratlosigkeit, nach zwei pausenlosen, dramaturgisch unendlich holprigen, psychologisch nicht zu erspielenden, gedanklich immer wieder unausgegorenen Stunden.
Der Abend verläuft zweisprachig, der deutsche Text wird an der Rampe in Ungarisch übersetzt, der Ungarische, der von dem Mann gesprochen wird, erscheint auf Deutsch am oberen Rand des Hauses. Der „Böse“, der aus Ungarn kommt, die gewalttätige, faschistische Gefahr, trägt dabei den Namen János – er und Ilona sind die Helden eines romantischen ungarischen Gedichts, dessen Ideale Schilling mit dieser Namensgebung hinterfragt. Zsolt Nagy, den eine lange Geschichte mit Árpád Schilling verbindet, bringt als dieser János all die rücksichtslose Härte mit, die die Schwachen angeblich so fasziniert – er muss am Ende nackt auf der Bühne verenden, wohl ein Wunschtraum des Autor / Regisseurs in Hinblick auf gegenwärtige Machthaber in seiner Heimat.
Ilona, die Ungarin, die vor János und der Gewalt geflüchtet ist und nur warnen will, spricht das gebrochene Deutsch des Dienstpersonals und bringt in Gestalt von Lilla Sárosdi die gewünschte positive Ausstrahlung – sie darf am Ende flüchten, schwanger davonkommen, die Frauen sind als Retterinnen gedacht. Auch Judith, wobei man Alexandra Henkel die oberflächliche Zicke des Beginns weit eher glaubt als die rettende, mordende Heldin des Endes.
Wandlungen sind auch für die Männer vorgesehen – Falk Rockstroh als Vater vom weinerlichen Intellektuellen zum geduckten Mitläufer, Martin Vischer vom schwächlich kiffenden Sohn zum brutalen Täter, der mit der Waffe in der Hand ein anderer Mensch ist. In einer „Skype“-Szene darf sich der Sohn des ungarischen Paares (András Lukács) noch kurz als linientreu outen.
Das bunkerartige Haus mit den großen Fenstern (Ausstattung: Juli Balázs) steht auf Stelzen und führt mit Leitern in die Tiefe (warum?), gespielt wird drinnen und draußen (immer mit Kopfmikrophonen), der tobende Sturm wird von schwarz gekleideten Männern erzeugt, indem sie Dinge auf der Bühne herumwerfen. Man hat von Árpád Schilling schon entschieden einfallsreichere Inszenierungen in Wien gesehen, sowohl den „Hamlet“ für drei Personen einst im Vestibül wie sein Budapester Gastspiele mit einer besonders starken „Möwe“-Aufführung.
Aber diesmal ging es ja vor allem um die Gesinnung. Dass die Qualität da sowohl dramaturgisch, literarisch wie inszenatorisch auf der Strecke geblieben ist, störte das begeistert jubelnde Premierenpublikum nicht. Man wusste sich dabei ja gefahrlos auf der Seite der richtigen Meinung.
Renate Wagner