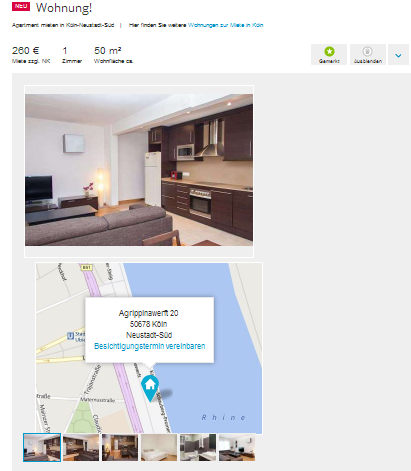David Stout (Sancho Pansa), Gábor Bretz (Don Quichotte) und (sitzend) Anna Goryachova (Dulcinea). Foto: Bregenzer Festspele / Dietmar Mathis
BREGENZ / Festspielhaus: DON QUICHOTTE von Jules Massenet
18. Juli 2019 (Premiere)
Sternstunden schauen anders aus
Von Manfred A. Schmid
Was hat Massenets Don Quichotte mit Don Quixote von Miguel Cervantes de Saavedra zu tun? -Herzlich wenig. Die Handlung seiner 1910 uraufgeführten Oper (nach einem Libretto von Henri Cain) reduziert die zu einem Stück Weltliteratur und so unsterblich gewordene Geschichte des „Ritters von der traurigen Gestalt“ auf eine banale Liebesgeschichte. Don Quichotte verliebt sich in Dulcinea, bei Massenet eine edle Dame, im Cervantes-Original eine arme Hure mit Herz. Als er ihr ein Ständchen darbringt, wird er von einem ihrer Verehrer gestört und zum Duell gefordert. Dulcinea greift ein, lobt seine Dicht- und Fechtkunst und meint: Wenn er die ihr gestohlene Halskette zurückbringe, werde er sie glücklich machen. Er verspricht, sich unter Einsatz seines Lebens dafür einzusetzen, was ihm dann auch gelingt – überraschenderweise, denn Don Quichotte ist im Original eigentlich kein Siegertyp, sondern zeigt seine menschliche Größe und Würde eher im konstanten Scheitern und niemals-aufgeben-Wollen. Doch seine Hoffnung, mit dieser Heldentat ihre Gunst und ihr Herz zu erringen, erfüllt sich nicht. Er stirbt und beschwört in an Dulcinea gerichteten Abschiedsworten seinen steten Einsatz für die Verwirklichung seiner Ideale und verspricht seinem treuen Diener Sancho Pansa die von ihm erhoffte „Insel der Träume“.
Dass sich aus dieser trivialen Geschichte trotz ihrer Dürftigkeit etwas machen lässt, hat Götz Friedrich 1974 an der Komischen Oper in – damals noch – Ost-Berlin gezeigt. In einer kühnen politischen Interpretation des Stoffes, in der er die Handlung ins Erscheinungsjahr der Oper verlegt, ist sein „Mann von La Mancha“ kein – wie bei Cervantes – zu spät gekommener Ritter, sondern ein zu früh gekommener Sozialrevolutionär. Die Sancho Pansa versprochene Trauminsel ist bei ihm also die prophezeite Verwirklichung einer Sozialutopie. Tatsächlich gibt es für so eine Deutung mehrere Belege im Libretto, wenn etwa Don Quichotte im 3. Akt in einer großen Rede der Räuberbande von seinen öko-sozialen Ideen vorschwärmt und den Räuberhauptmann und dessen Kumpanen damit so in Rührung versetzt, dass ihm schließlich sogar Dulcineas gestohlene Kette reumütig ausgehändigt wird. Da stimmen sozialistische Gesellschaftsmodelle mit urchristlich-kommunistischen Lebensformen und – aus heutiger Sicht – „grünem“ Gedankengut in einer diffusen Sozialutopie überein.
Auch die Bregenzer Inszenierung von Mariame Clément beginnt vielversprechend. Bevor sich der Vorhang öffnet, wird – wie bei einer Kinovorführung – zuerst einmal ein Werbespot für Gillette gezeigt. Das Publikum reagiert irritiert: Muss das sein? Sind wir jetzt so weit, dass auch schon Hochkulturevents nicht mehr ohne explizite Werbung für einen Großkonzern möglich sind? Ein (vermeintlicher, wie sich alsbald herausstellt) Zuschauer springt prompt auf und stellt lautstark die Frage, was denn Gillette mit der Oper und mit den Festspielen überhaupt zu tun haben soll. Erregt echauffiert er sich über die hier stattfindende Manipulation durch Reklame. Allmählich dämmert einem und man beginnt zu begreifen: Hier wird vorgeführt, dass es sich lohnt, Missstände aufzuzeigen und dagegen vorzugehen, auch wenn man es mit mächtigen Konzernmultis zu tun hat und das beherzte Engagement von Vornherein eher einem Kampf gegen Windmühlen gleicht und – donquichottesk – nicht gerade erfolgversprechend zu werden scheint.
Leider werden die hohen Erwartungen nicht eingelöst. Zwar geht auch hier die Regie von der Überzeugung aus, dass Don Quichotte in jeder Epoche aktuell ist. Der erste Akt spielt im historischen Rahmen zur Lebzeit seines Schöpfers Cervantes, in den folgenden Akten findet sich der Anti-Held im ausgehenden 20. Jahrhundert und in die unmittelbaren Gegenwart wieder, bis dann am Schluss die Sterbeszene erneut in die Entstehungszeit der Romanvorlage verlegt wird.
Das ist legitim und unterstreicht die wirkungsgeschichtliche Bedeutung der Figur, die – wie sonst nur noch Goethes Faust oder der Fischer in Hemingways Der alte Mann das Meer – die Möglichkeit menschlicher Existenz aufzeigt: „Man can be destroyed but not defeated“ (Der Mensch kann vernichtet, aber nicht besiegt werden.) Scheitern und immer wieder Aufstehen und für seine Ideale Weiterkämpfen: eine lebenslange Herausforderung.
Gerade das aber funktioniert hier nicht. Denn wir haben es in allen Akten mit grundverschiedenen Don-Quichotte-Abarten zu tun, die allesamt mit dem cervantischen Caballero nur wenig Berührungspunkte aufzuweisen haben. Im ersten Akt tritt er als angesehener, von der Bevölkerung hochgeschätzter und verehrter Edelmann auf, der angeblich bravourös mit dem Degen umzugehen versteht und obendrein ein großer Dichter sein soll. Im Original gilt er freilich als unverbesserlicher Schwärmer und schrulliger Phantast, dem mehr Spott entgegengebracht wird als Hochachtung. Völlig lächerlich macht er sich dann im zweiten Akt, wo er in einem Badezimmer beim Rasieren neue Verse auf die angebetete Dulcinea rezitiert, während sein Diener frauenfeindliche Äußerungen von sich gibt und dabei unentwegt auf seinen Laptop starrt. Bis sein Herr in den rotierenden Ventilatorblättern böse Ritter zu erkennen glaubt und gegen sie – mit untauglichen Mitteln (Handtücher) – zu Felde zieht. Es handle sich dabei in Wahrheit um Windmühlen, klärt ihn der ansonsten für seinen bauernschlauen Realitätssinn bekannte Sancho Pansa auf. Daraus lässt sich nur der Schluss ziehen, dass sich das Badezimmer in einer Nervenheilanstalt befindet und der Herr und sein Knecht dort als Patienten eingewiesen worden sind.
Im dritten Akt trifft man auf einen Don Quichotte, der mit einer Art Spiderman-Kostüm bekleidet vor einer mit Graffiti beschmierten Wand mit der Aufschrift „WE COULD BE HEROES“ steht. Dort wird er von einer Gang jugendlicher Rowdies attackiert und niedergeschlagen. Als er sich – blutverschmiert, aber unverdrossen – wieder aufrichtet und den Jugendlichen eine Predigt hält, wird er von ihrem Anführer mit Jesus verglichen, erhält Dulcineas Schmuckstück zurück und wird als Heiliger verehrt. Im folgenden Akt überreicht er seiner Angebeteten, nun eine Karrierefrau in einem topmodernen Büroumfeld, die Halskette und macht ihr einen Heiratsantrag. Dieser wird abgelehnt. Mit Begründung, dass er viel zu gut für sie sei. Im Schlussakt kommt es dann zu seiner – überspitzt formuliert – pseudoreligiös verbrämten Heiligsprechung und Himmelfahrt.
Die Basis dieser verschmockten, unerträglich kitschigen Inszenierung liefert ohne Zweifel Massenets Libretto-Vorlage. Dass aber hier nicht einmal der Versuch unternommen wird, diesen Schmarren zu hinterfragen oder wenigstens zu ironisieren, ist dem leading team anzulasten. Nur eine Zeitverschiebung vorzunehmen (Bühne & Kostüme Julia Hansen) genügt nicht, sondern ist nicht mehr als das billige Abfüllen längst ungenießbar gewordenen alten Weins in auf modern getrimmte, neue Schläuche.
Leider ist auch die musikalische Umsetzung nicht dazu angetan, Massenets Veroperung dieses die Intentionen seines ursprünglichen Schöpfers eher nur verhunzenden Librettos auch nur ansatzweise zu rehabilitieren. Die paar spanischen Anklänge im ersten und vierten Akt reichen nicht, dieser Musik nachhaltige Wirkung zu verleihen. Tschaikowskys nüchterner Befund über Massenets Manon – „die Musik ist sehr anmutig, klug und voller Sorgfalt komponiert, doch es fehlt jeder Funke an echter Inspiration“ – mag angesichts der Erfolgsgeschichte der von ihm so vernichtend kritisierten Oper etwas überzogen sein, auf seinen Don Quichotte trifft sie haargenau zu. Da können sich die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Daniel Cohen noch so bemühen, da ist nichts zu machen. Das ist gekonnter, verstaubt anmutender Akademismus, mehr nicht.
Gesungen wird brav. Anna Goryachovas Belcanto erprobter Mezzosopran verleiht der Dulcinea die Aura einer unnahbaren, kapriziösen Dame aus der high society. Was ihren Reiz für Don Quichotte ausmacht, erschließt sich aber kaum. Der Bass Gabor Bretz beweist genug Anpassungsfähigkeit, um der Titelpartie auf den unterschiedlichen Zeitebenen das jeweils geforderte Profil zu verleihen. David Stout sorgt als treuherziger und wachsamer Diener seines Herrn für die dankbar registrierten komischen Momente in einer über weite Strecken hinweg eher tragisch verlaufenden Geschichte. Zudem weiß er mit seinem warm timbrierten Bariton die Sympathien des Publikums auf seiner Seite. Einsatzfreudig agiert und singt der Prager Philharmonische Chor.
Der Schlussbeifall fällt freundlich aus, rund ein Drittel des Publikums im Parterre verhält sich dabei aber eher passiv. Kein Wunder: Sternstunden schauen anders aus.
Manfred A. Schmid (Merker Online)
19.7.2019