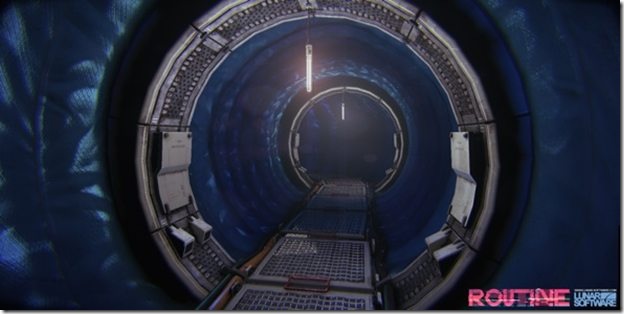WIEN / Staatsoper:
ANDREA CHÈNIER von Umberto Giordano
101. Aufführung in dieser Inszenierung
3. Mai 2014
Um halb 6 Uhr kam sie in die Wiener Staatsoper, um 7 Uhr 5 Minuten hatte sie ihren Auftritt als Maddalena di Coigny: Hätte María José Siri nichts weiter getan, als nach der mittägigen Absage von Norma Fantini diese Vorstellung von „Andrea Chénier“ zu retten, wäre ihr schon Lob und Preis gewiss gewesen. Aber die exotische Schönheit aus Uruguay (Landsfrau von Erwin Schrott also) tat viel mehr: Sie holte sich den Abend. Ihre Maddalena war das absolute Glanzstück.
Warum? Weil sie einen fabelhaften dramatischen Sopran hat, der sie nie zum Forcieren zwingt, weil sie die Spitzentöne des Verismo so souverän schmettern wie sie tragfähige Piani bieten kann. Und „La Mamma morta“ ist rein von der Technik her eine mörderisch schwere Arie, die ihr keine Minute Schwierigkeiten bereitete, sondern mit vollem emotionalen Ausdruck und schwelgerischer Schönheit gesungen wurde. Nein, das bringt nicht jede Einspringerin.
Als sie im ersten Akt auf die Bühne hüpfte und das Aristokratentöchterchen wie einen hyperaktiven Teenager verkörperte, war man nicht sicher, was daraus werden würde, aber sie entwickelte sich von Akt zu Akt über die Gebrochenheit durch ihr plötzlich zerstörtes Leben gänzlich folgerichtig zur heroischen Liebenden, die mit Chenier in den Tod stürzt, weil es für sie keine bessere Lösung geben kann. Kurz, das war beeindruckend.
Der Titelheld ist eine tenorale Traumrolle, drei große, berühmte Arien, zwei Duette mit dem Sopran, wobei das letzte ohnedies ein Höhepunkt der veristischen Opernkunst schlechthin ist. Das Ganze mit den entsprechenden Ansprüchen an einen Interpreten. Man kann wohl sagen, dass nach dem Tod von Pavarotti (denken wir an seine große Zeit, nicht an die wacklige Wiener Premiere unter damals so unglücklichen Umständen) wenige den Chenier singen können wie Johan Botha, von der Kraft und Qualität der Stimme her, der noblen Stimmführung und großartigen Technik – und natürlich der Fähigkeit zu gewaltigen Spitzentönen: Von denen hörte man einige beeindruckende (vor allem in der „Si, fui Soldato“-Arie). Dennoch schien es, als hätte Botha nicht seinen allerbesten Abend, als hätte sich vielleicht ein Schnupfen zwischen ihn und die volle Entfaltung seiner stimmlichen Schönheit geschlichen. Aber auch ein Botha minus zehn Prozent ist noch immer – sehr viel.
Anthony Michaels-Moore, mit Ausnahme von zwei „Stiffelio“-Vorstellungen 2009 sehr lange nicht in Wien gewesen, sang den Carlo Gérard. Das war mit seiner ausgesprochen trockenen Stimme, die er zu Höhen und Forte hörbar forcieren musste, nun nicht das Gesangsfest, das gesunde italienische Baritone in dieser so dankbaren, reichen Partie zu bieten pflegen (pflegten). Aber immerhin war er auch stimmlich und mehr noch darstellerisch ein wirklich eindrucksvoller Gestalter dieses scheinbaren Bösewichts, der ja dann doch seine edle Seite entdeckt: Schmal und blass und groß ist er schon im ersten Akt der geborene Fanatiker und Führer, später der von Liebe und Eifersucht Besessene, bis seine Zuneigung zu Maddalena stärker ist als alles, was er auch in vielen schönen Details spielt. Kurz, man wird ihn als interessanten Interpreten der Rolle in Erinnerung behalten – und sich fragen, ob er nicht bei Britten oder den Modernen besser eingesetzt wäre.
Die leidige Frage der Nebenrollen, die im „Andrea Chénier“ besonders zahlreich sind, wurde zumindest mit einigen Herren mehr als positiv beantwortet – wenn man Norbert Ernst, der als Incroyable eine glänzende Intrigantenstudie liefert, Boaz Daniel als treuen Freund und edlen Bariton und Alfred Šramek (der übrigens nach der Vorstellng zum Ehrenmitglied des Hauses ernannt wurde, wir gratulieren!), der Humor in der Tragik verstreute, aufbieten kann, bleiben kaum Wünsche offen. Bei den Damen reüssierte vor allem Alisa Kolosova als Bersi, während Monika Bohinec als Madelon (was ist das für eine großartige Szene) und Aura Twarowska als harsch über ihr Reich herrschende Contessa di Coigny entschieden weniger gut klangen.
Die so unglaublich reiche Partitur des „Andrea Chénier“, die vom Rokoko-Menuett bis zum grölenden Volk reicht und vor allem an Verismo-Belcanto überströmt, war bei Paolo Carignani in ausgezeichneten Händen.
Und schließlich muss man noch die glänzende Inszenierung von Otto Schenk loben, die alles zeigt, was im Libretto und in der Partitur steht, ohne alberne „Oper“ daraus zu machen. Man spielte das Werk in dieser Produktion bereits 101mal. Ad multos annos! Dass nur niemand auf die Idee kommt, diese Inszenierung so sinnlos zu ersetzen wie es nun Kupfers fabelhafter “Elektra” bevorsteht…
Renate Wagner